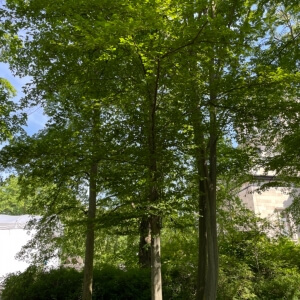https://www.naturadb.de/pflanzen/syringa-vulgaris/

Gemeiner Flieder ist eine invasive Art und schädigt die Natur, indem sie die Artenvielfalt bedroht. Bitte pflanze diese Art nicht - vielen Dank!
| Licht: | Sonne bis Halbschatten |
| Boden: | durchlässig bis humos |
| Wasser: | trocken |
| Nährstoffe: | nährstoffreicher Boden |
| PH-Wert: | basisch / kalk |
| Pflanzenart: | Gehölz |
| Wuchs: | aufrecht, ausladend, dicht |
| Höhe: | 4 - 6 m |
| Breite: | 2,5 - 3,5 m |
| Zuwachs: | 20 - 30 cm/Jahr |
| schnittverträglich: | ja |
| frostverträglich: | bis -34 °C (bis Klimazone 4) |
| Wurzelsystem: | Tiefwurzler |
| Wurzelausläufer: | Ausläufer |
| Blütenfarbe: | lila |
| Blühzeit: | |
| Blütenform: | rispenförmig |
| Blütenduft: | ja |
| Fruchtfarbe: | braun |
| Blattfarbe: | frischgrün |
| Blattform: | breit eiförmig |
Gemeiner Flieder ist eine invasive Art und schädigt die Natur, indem sie die Artenvielfalt bedroht. Bitte pflanze diese Art nicht - vielen Dank!
Was sagen mir die Daten?| Pflanzen je ㎡: | 1 |

Gemeiner Flieder ist eine potenziell invasive gebietsfremde Art. Es liegt die begründete Annahme vor, dass sie heimische Arten verdrängt und die Biodiversität gefährdet. Mehr zum Thema liest du auf der Seite invasive Pflanzen.
Pflanze im Zweifelsfall lieber heimische Pflanzen. Unsere Insekten und Tiere sind auf sie angewiesen.
Unsere Quellen
Gemeiner Flieder (Syringa vulgaris) ist ein beliebter Zierstrauch, der bei uns seit dem 16. Jahrhundert kultiviert wird und vielerorts ausgewildert wächst. Man findet ihn vor allem in warmen Gebüschen, an Steilhängen und trockenen Felslagen, wo er oftmals dichte Bestände bildet. Beheimatet ist der Vertreter aus der Familie der Ölbaumgewächse (Oleaceae) ursprünglich im Südosten Europas, von Rumänien und Bulgarien bis nach Serbien, Albanien, Mazedonien und das nordöstliche Griechenland.
Der sommergrüne, 2-6 Meter, selten sogar bis 10 Meter hohe Strauch oder Baum verfügt über ein kräftiges und weitreichendes Wurzelwerk. Die Borke ist grau und längsrissig und löst sich in langen Streifen ab. Oft erscheinen die straff aufrechten Äste in sich selbst verdreht. Junge Zweige sind kahl, gerade und olivgrün gefärbt, mit wenig hervortretenden Korkwarzen; erst später nimmt ihre Rinde die typische graue Farbe an. Die Endknospen verkümmern früh; an ihrer Stelle verzweigen sich die spitzennahen Seitenknospen und bilden gabelige Triebe. Ihre Knospen sind eiförmig, bis einen Zentimeter lang und kahl.
Die derben gegenständigen Blätter haben einen 1,5-2,5 Zentimeter langen Stiel und einen herzförmigen bis ovalen Umriss. Ihre beidseits kahle, oberseits leicht glänzende Blattspreite misst 8-10 Zentimeter in der Länge und 5-7 Zentimeter in der Breite, der Rand ist ganz und läuft in eine lange Spitze aus.
Beim Gemeinen Flieder erscheinen die Blüten im Mai und Juni in 15-20 Zentimeter langen konischen Rispen. Sie sind zwittrig und vierzählig mit doppelter Blütenhülle; der Kelch bleibt klein und unscheinbar, die Krone ist am Grunde zu einer engen, 10-15 Millimeter langen Röhre verwachsen, die von den vier 4-5 Millimeter langen runden und schälchenförmigen Kronzipfeln überragt wird. Ihre Farbe ist blauviolett, seltener weiß. Die beiden Staubblätter schauen nicht aus der Kronröhre hervor, und der Fruchtknoten ist oberständig.
Aus Letzterem bildet sich eine zweifächerige Kapsel von 15-17 Millimetern Länge; sie ist leicht zusammengedrückt und zugespitzt. Bei der Reife trocknet sie ein und öffnet sich an ihrer Spitze mit zwei Klappen und gibt die rundum geflügelten, etwa einen Zentimeter langen Samen frei.

Flieder ist recht anspruchslos; ihm reicht ein durchlässiger, nährstoffreich-humoser und nicht zu saurer Boden. Er sollte möglichst viel Sonne bekommen, damit er auch reichhaltig blüht. Frost macht ihm nur in jungen Jahren etwas aus, wo er empfindlich auf Spätfröste reagiert. Später ist er vollkommen winterhart.
Damit der Flieder stets reichlich blüht solltest Du die abgeblühten Triebe regelmäßig entfernen, sobald sie verwelkt sind. In den ersten Jahren nach dem Setzen empfiehlt es sich, die Äste unmittelbar nach der Blütezeit radikal um ein Drittel einzukürzen – dadurch verzweigt sich der Busch viel reichhaltiger und die Krone wird schöner.
Zweige, die bereits zweimal geblüht haben, kann man auf einen kräftigen Seitentrieb zurückschneiden. Wildtriebe aus den Unterlagen der veredelten Sorten musst Du rechtzeitig entfernen, bevor sie die Edelreiser überwuchern. Gegebenenfalls musst Du dafür auch ein bisschen graben, wenn sie in der Nähe des Busches aus der Erde kommen.
Besonders reichhaltigen Blütenansatz wirst Du bekommen, wenn Du den Flieder nicht nur regelmäßig ausputzt und schneidest, sondern auch im Sommer regelmäßig mit einem Volldünger versorgst.
Die Wildform von Gemeiner Flieder kann man unmittelbar nach der Reife im Herbst aus Samen ziehen oder grüne Stecklinge im Frühsommer nehmen. Absenker sind ebenso leicht zu bewurzeln. Bei den Sorten ist nur eine vegetative Vermehrung möglich; die meisten im Handel erhältlichen Sorten sind auf eine wüchsige und robuste Unterlage gepfropft.
Flieder nennt man botanisch einen Intensivwurzler – mit sein weitreichenden dichten Wurzelsystem ist er auch ein ausgezeichneter Bodenfestiger für warme Hanglagen. Er gilt als rauchhart und ist auch für das Stadtklima geeignet. Deshalb ist er für die Strauchrabatten in öffentlichen Parkanlagen so beliebt.
Du kannst ihn an augenfälliger Stelle einzeln pflanzen, sodass er im Frühjahr mit seiner Blütenpracht besonders ins Auge sticht. Freiwachsende Hecken sind ein Blickfang – und lassen sich auch gut mit Rosen kombinieren, die wenig später im Jahr mit ihrer Blüte beginnen.
Beliebt ist Gemeiner Flieder auch als Schnittblume. Aus den Blumengeschäften ist er zu seiner Hauptblütezeit ebenso wenig wegzudenken wie aus den Vasen seiner LiebhaberInnen. Hierfür schneidest Du die Blütenstände am besten, wenn sie noch weitestgehend im Knospenstadium sind – in der Wärme gehen sie schnell auf.
Vor allem im Sommer wird Flieder häufig von Mehltau heimgesucht. Blattläuse sind Dauergäste freuen sich darauf, mit den Blüten ins Haus geholt zu werden. Ebenso treten Viruskrankheiten und Thripse auf, bei geschädigtem Holz Hallimasch.
Die grüngelben Raupen der Fliedermotte (Gracillaria syringella) erkennt man daran, dass sie die Blätter minieren und später tütenartig zusammenrollen. Niemsamen helfen mindestens genauso gut wie die chemische Keule, denn überhand nehmen lassen sollte man die Fliedermotten nicht: Sie befallen auch Esche, Liguster, Pfaffenhütchen und Forsythie und können die Bäume und Sträucher bei übermäßigem Befall nicht nur schädigen, sondern sogar umbringen.
Ebenfalls Vorsicht geboten ist bei der Fliederseuche. Sie wird durch das Bakterium Pseudomonas syringae pv. syringae hervorgerufen und äußert sich mit braun und letztlich schwarz werdenden Blättern und Trieben, die letztlich umknicken. Hier solltest Du die betroffenen Äste großzügig entfernen und unbedingt über den Restmüll entsorgen – bloß nicht im Kompost. Denn die bösen Bakterien befallen ebenso Steinobst wie Pflaume und Aprikose, aber auch Forsythie, Pfeifenstrauch und Bohnen. Andere Stämme der Gram-negativen Stäbchen machen sich so ziemlich über alles her, was der Garten hergibt, von der Tomate über Ahorn bis Wildapfel und Kartoffel -nichts, was man im Haus- und Nutzgarten haben möchte. Einen umfangreichen englischsprachigen Review zu Pseudomonas syringae findest Du hier.
Neben dem Gemeinen Flieder gibt es in Gärten häufig noch andere, vorwiegend aus Asien stammende Ziersträucher der gleichen Gattung Syringa. Insgesamt gibt es etwa 30 Arten, die im Gebiet zwischen Südosteuropa und Ostasien beheimatet sind, mit einem Verbreitungszentrum in Nord- und Zentralchina. In seiner Heimat ist er oft mit Orient-Hainbuchen, Blumen-Esche, Flaum-Eiche und Buchsbaum vergesellschaftet.
Der Gemeine Flieder wurde 1560 vom Gesandten von Kaiser Ferdinand I, Ogier Ghislain de Busbecq, der auch ein begeisterter Botaniker war, nach Wien gebracht – zusammen mit den ersten Hyazinthen und Tulpen, die wenige Jahre später in Holland und Europa zur Tulipomanie, dem Tulpenwahn führte. Entgegen sich hartnäckig haltenden Gerüchten waren Lilien und Rosskastanien nicht dabei – die überreichte Sultan Suleyman erst seinem Nachfolger. Ganz so dramatisch wie bei den Tulpen gestaltete sich die Einführung in den Gärten Europas beim Flieder nicht, aber er ist bis heute ein äußerst beliebter Zierstrauch, der mit seinen prächtigen und wohlriechenden Blütenständen begeistert.
Im ausgehenden 19. Jahrhundert bemühten sich vor allem französische Gärtner um Neuzüchtungen. Ähnliches gilt neben der Wildform auch für viele asiatische Arten. Inzwischen gibt es eine Unzahl von Fliedersorten, die sich durch Wuchshöhe, Größe und Farbe der Blütenstände und ihren Duft unterscheiden. Darunter sind auch einige gefüllte Sorten. Besonders hervorgetan hat sich der Gärtner Victor Lemoine aus Nancy, der über 153 Sorten einführte, von denen noch heute viele als Klassiker im Handel sind. Häufig spricht man von Edelflieder.
Die züchterischen Bemühungen haben bei den Sorten von Gemeiner Flieder eine ganze Palette von Farben hervorgebracht. Sie sind weiß, rosa, magenta, rot, blau bis tief lila. Oft sind die Knospen noch intensiver gefärbt als die sich öffnenden Blüten.
Die vielen Sorten, die dem Gewöhnlichen Flieder auch den Namen Französischer Flieder eingebracht haben, haben zu dieser Zeit auch die Maler des Impressionismus begeistert. Fliederblüten waren beliebte Motive und wurden unter anderem von Edouard Manet, Paul Gauguin und Vincent van Gogh gemalt.
Mit ihrem Wohlgeruch wurden die Fliederblüten schon frühzeitig von Parfümeuren entdeckt. Das ätherische Öl wird durch Wasserdampfdestillation gewonnen und ist Bestandteiler vieler Duftkompositionen.
Fliederholz ist leider nur knapp bemessen, da die Stämmchen nur relativ wenig Material hergeben. Für Drechselarbeiten und Intarsien ist es äußerst beliebt, denn es ist extrem hart und lässt sich gut polieren. Das Splintholz hat eine gelbliche bis rötlich weiße, das Kernholz eine braune bis hellviolette Farbe.
hat eine ziemlich kurze Geschichte – früher war das die übliche deutsche Bezeichnung für Holunder, der erst nach der Umwidmung seines alten Namens allgemein so genannt wird. Gehalten hat er sich in den Fliederbeeren, wie man die Holunderbeeren noch heute im Norden Deutschlands heißt. Der botanische Name Syringa leitet sich von lateinisch syrinx, Rohr oder stellvertretend für die Panflöte ab, wegen der langen geraden Triebe. Den Namen hat der Vater der botanischen Nomenklatur Carl von Linné höchstpersönlich eingeführt.
Umgekehrt hat der Flieder seinen Spuren im Deutschen hinterlassen: Etwas ist lila gefärbt? Da ist der Gemeine Flieder quasi der Archetypus, denn lilas heißt der Flieder im Französischen. Den hat man wiederum von den Osmanen übernommen, genauer aus dem Persischen.

Bedenke, die auf heimische Wildpflanzen angewiesenen Tierarten, wie die meisten Wildbienen- und Schmetterlingsarten sowie davon abhängige Vögel, sind von einem dramatischen Artenschwund betroffen. Mit heimischen Arten kannst du etwas zum Erhalt beitragen.


| Pflanze | Wuchs | Standort | Blüte |
|---|---|---|---|
| Gemeiner FliederSyringa vulgarisWildform | aufrecht, ausladend, dicht 4 - 6 m 2,5 - 3,5 m |
| |
| Weißer WildfliederSyringa vulgaris 'Alba'reinweiße Blütenrispen, duftend | aufrecht, strauchartig, dicht verzweigt 4 - 5 m 2,5 - 3,5 m |
| |
| Edelflieder 'Alice Harding Weiß'Syringa vulgaris 'Alice Harding Weiß'gefüllte, weiße Blüte | aufrecht 1,5 - 2 m 80 - 100 cm |
| |
| Edelflieder 'Amethyst'Syringa vulgaris 'Amethyst'gut frosthart, große violette Blütenrispen | aufrecht, buschig 4 - 5 m 4 - 5 m |
| |
| Edelflieder 'Andenken an Ludwig Späth'Syringa vulgaris 'Andenken an Ludwig Späth'stark duftende Blüten | aufrecht, steiftriebig 2,5 - 3,5 m 1,5 - 2 m |
| |
| Gemeiner Flieder 'Beauty of Moscow'Syringa vulgaris 'Beauty of Moscow' | aufrecht, strauchartig, dicht verzweigt 2,5 - 4 m 2 - 3 m | ||
| Edelflieder 'Belle de Nancy'Syringa vulgaris 'Belle de Nancy'zarte Blütenfärbung | aufrecht, dicht verzweigt 4 - 6 m 2 - 3 m | | |
| Edelflieder 'Charles Joly'Syringa vulgaris 'Charles Joly'stark duftend, sehr anpassungsfähige Sorte | aufrecht, buschig 2,5 - 3,5 m 1,2 - 1,8 m |
| |
| Edelflieder 'Dentelle d Anjou'Syringa vulgaris 'Dentelle d Anjou'winterhart, weiße Blüten | aufrecht, stark verzweigt 2,5 - 3 m 2,5 - 3 m |
| |
| Edelflieder 'Katharine Havemeyer'Syringa vulgaris 'Katharine Havemeyer'halb-bis dicht gefüllte Blüte, stark duftend | aufrecht, dicht 4 - 6 m 3 - 5 m |
| |
| Gemeiner Flieder 'Lila Wonder'Syringa vulgaris 'Lila Wonder' | aufrecht, dicht verzweigt 1,8 - 6 m 2 - 3 m | ||
| Edelflieder 'Maidens Blush'Syringa vulgaris 'Maidens Blush'purpurrote Knospen, hellrosa Blüten | aufrecht, dichtverzweigt 2,5 - 3,5 m 1,5 - 2,5 m |
| |
| Edelflieder 'Michel Buchner'Syringa vulgaris 'Michel Buchner'duftende Blüten und bildet Wurzelausläufer | aufrecht 2,5 - 3,5 m 1,2 - 1,8 m |
| |
| Edelflieder 'Mme Antoine Buchner'Syringa vulgaris 'Mme Antoine Buchner'sehr schöne malvenrosa Blüte | aufrecht, dicht verzweigt 3 - 5 m 1,5 - 2 m |
| |
| Edelflieder 'Mme Lemoine'Syringa vulgaris 'Mme Lemoine'gefüllte, stark duftende Blüte, | aufrecht, dicht verzweigt, buschig 2,5 - 3 m 1,5 - 1,8 m |
| |
| Edelflieder 'President Poincare'Syringa vulgaris 'President Poincare'leicht gedrehte Blütenblätter | aufrecht, buschig 4 - 6 m 80 - 200 cm |
| |
| Edelflieder 'Primrose'Syringa vulgaris 'Primrose'einzig gelbe Sorte, winterhart und duftend | aufrecht, dicht 4 - 6 m 3 - 5 m |
| |
| Edelflieder 'Prince Wolkonsky'Syringa vulgaris 'Prince Wolkonsky'Wechseln der Farbe in der Blüte | aufrecht, dicht verzweigt 3 - 4 m 3 - 4 m |
| |
| Edelflieder 'Schöne aus Moskau'Syringa vulgaris 'Schöne aus Moskau'gefüllte, creme weiß bis rosa Blüten | aufrecht, strauchartig, dicht verzweigt 2,5 - 4 m 2 - 3 m |
| |
| Edelflieder 'Sensation'Syringa vulgaris 'Sensation'sehr schöner Farbkontrast der Blüten | aufrecht 2,5 - 4 m 1,2 - 1,8 m |
|
sind mit meist 3-5 Metern Höhe noch etwas kleiner als die Wildform. Bei vielen gefüllten Sorten hält sich der Geruch in Grenzen. Zudem gehen Insekten bei ihnen leer aus, da die Zusatzblätter den Weg zum Nektar versperren. Viele der Klassiker stammen noch aus der Zucht des berühmten Monsieur Lemoine.
Meistens wächst der Flieder eher als großer Strauch mit aufrechten Ästen denn als Baum. Aber im Alter kann er durchaus auch zum kleinen Baum mit einer ausladenden Krone werden, wenn man ihn entsprechend regelmäßig schneidet.
Die Wildform wird meist 2-6, in seltenen Fällen sogar bis zu zehn Meter hoch. Im Garten findet man jedoch wesentlich häufiger eine der zahlreichen Zuchtformen. Diese bleiben größtenteils deutlich kleiner, oft auch nur zwei oder drei Meter.
Nein. Wild wächst er in Südosteuropa, vor allem auf dem Balkan an trockenen und felsigen Hängen und Gebüschen. Oft bildet er zusammen mit Blumen-Esche, Flaum-Eiche, Buchsbaum und Orient-Hainbuchen lockere Bestände.
Bei uns eingeführt wurde er erst 1560, als der Gesandte von Kaiser Ferdinand I. ihn vom osmanischen Hof in Konstantinopel mitbrachte. Zunächst führte er ein Schattendasein in botanischen Gärten, bis ihn französische Züchter wie der berühmte Victor Lemoine für sich entdeckten und zahlreiche Sorten hervorbrachten.
Heute ist er aus deutschen Gärten nicht mehr wegzudenken, und vielerorts ist die winterharte Pflanze ausgebüchst und macht sich an exponierten Steillagen breit. In der Nähe von alten Burgruinen, auf Felsriegeln und baumfreien sommerwarmen Abhängen bildet er häufig große Ansammlungen und ist inzwischen vielerorts fester Bestandteil der Gesellschaft des Berberidions mit Schlehen und Felsbirnen.
Gemeiner Flieder ist eine invasive Art Diese Art wandert unkontrolliert in die umliegende Landschaft aus und schädigt die Natur durch eine Reduktion der Artenvielfalt nachhaltig.
Möglicherweise ernähren sich von dieser Pflanze nicht spezialisierte Insekten. Der ökologische Schaden ist allerdings größer als der Nutzen.
Bitte pflanze Gemeiner Flieder nicht - vielen Dank!