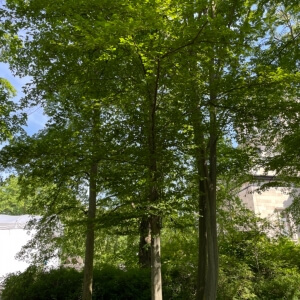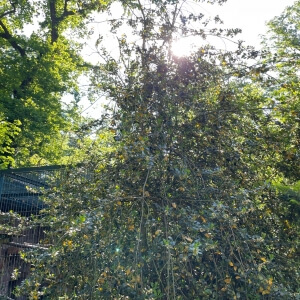https://www.naturadb.de/pflanzen/erica-tetralix/

| Licht: | Sonne bis Halbschatten |
| Boden: | humos |
| Wasser: | feucht |
| Nährstoffe: | nährstoffarmer Boden |
| PH-Wert: | sauer bis kalkhaltig |
| Kübel/Balkon geeignet: | ja |
| Pflanzenart: | Gehölz |
| Wuchs: | bodendeckend |
| Höhe: | 15 - 20 cm |
| Breite: | 10 - 50 cm |
| Zuwachs: | 5 - 10 cm/Jahr |
| schnittverträglich: | ja |
| Wurzelsystem: | Flachwurzler |
| Blütenfarbe: | weiß |
| Blühzeit: | |
| Blütenform: | kopfig-doldenförmig |
| Blattfarbe: | grau-grün |
| Blattphase: | wintergrün |
| Blattform: | nadelförmig, quirlständig |
| Bestandssituation (Rote Liste): | mäßig häufig |
| Gefährdung (Rote Liste): | Vorwarnliste |
| Wildbienen: | 9 (Nektar und/oder Pollen, davon 2 spezialisiert) |
| Schmetterlinge: | 1 |
| Raupen: | 13 (davon 6 spezialisiert) |
| Schwebfliegen: | 3 |
| Käfer: | 3 |
| Nektarwert: | 3/4 - viel |
| Pollenwert: | 1/4 - gering |
floraweb.de.
| Höhenlage: |
planar (<100m1 / <300m)2 bis kollin (100m-300m1 / 300m-800m)2 1 Mittelgebirge / 2 Alpen |
| ist essbar | Verwendung: Kräuteröl, -essig, Aroma für Gelee, Sirup, Zucker, Wein, Spirituosen, Bier, Gewürz, Streckmehl |

Heimische Wildpflanzen sind vielerorts selten geworden und damit die neuen Exoten in unseren Gärten. Sie sind, im Gegensatz zu Neuzüchtungen und Neuankömmlingen, eine wichtige Nahrungsquelle für Wildbienen und Schmetterlinge. In puncto Stand- und Klimafestigkeit sind sie anderen Arten deutlich überlegen. Auch kalte Winter überleben sie meist ohne Probleme. Gut für dich, gut für die Natur.
Also pflanzt heimische Arten, so wie diese!
Glockenheide, genauer Moor-Glockenheide oder kurz Moorheide (Erica tetralyx) ist ein einheimischer Vertreter der Erikagewächse (Ericaceae), der in Deutschland seinen Verbreitungsschwerpunkt in der norddeutschen Tiefebene hat. Sie ist eher selten, zum Teil eingeschleppt und eingewandert und findet sich in Heidemooren auf nassen sauer-humosen Sand- oder Torfböden.
Es handelt sich dabei um einen ausdauernden und immergrünen 15-20 Zentimeter hohen Zwergstrauch, der im unteren Teil verholzt. Die stumpflichen nadelförmigen Blätter sind mit drüsigen Haaren steif bewimpert, am Rand nach unten eingerollt und werden bis zu sechs Millimeter lang. Sie stehen quirlständig und abstehend am Stängel.
Blütenstände sind kleine kopfige Dolden mit 5-15 einzelnen Blüten. Diese sind zwittrig, fünfzählig, ohne Kelch, mit 6-9 Millimeter langen verwachsenen Kronblättern, die eine rosa Farbe haben und ein eiförmiges, vorne fast geschlossenes Glöckchen bilden. Sie vertrocknen nach der Bestäubung, fallen aber nicht ab und verbleiben an der Pflanze. Im Inneren beherbergen sie dann die kleinen kugeligen Kapselfrüchte mit zahlreichen winzigen Samen.

Die Moor-Glockenheide wächst bevorzugt auf einem nassen, nähstoff- und basenarmen sauren Torfboden oder sauer-humosen Sandboden in voller Sonne oder mit leichtem Halbschatten. Kalk verträgt sie nicht, wohl aber vorübergehendes Austrocknen.
Schneidet man die Glockenheide regelmäßig nach der Blüte zurück, wächst sie buschiger, vergreist nicht so schnell und blüht weiterhin reichhaltig.
Die Vermehrung der Glockenheide erfolgt am einfachsten mit Ablegern oder Stecklingen. Eine Anzucht aus Samen ist sehr langwierig, sodass man mit jungen Pflanzen aus dem Gartencenter deutlich besser fährt.
Mit ihrem niedrigen Wuchs und hübschen Blüten ist die Moor-Glockenheide ein idealer Bodendecker für feuchte Stellen im Garten, etwa im sumpfigen Einzugsbereich eines Gartenteiches.
Schädlinge und Krankheiten spielen bei der recht robusten Glockenheide kaum eine Rolle. Mitunter finden sich Pilzerkrankungen wie der Mehltau oder Rostflecken. Für Schneckensind sie uninteressant, und Blattläuse sieht man eher selten.

Die Glockenheide ist eine wichtige Raupen-Futterpflanze für Schmetterlinge – insgesamt 14 Arten legen hier ihre Eier ab, darunter auch vom Aussterben bedrohte Arten wie der Heidekraut-Fleckenspanner (Dyscia fagaria) und der Heide-Bürstenspinner (Orgyia antiquoides).
Hauptbestäuber der Glockenheide sind Blasenfüße, vor allem die nur einen Millimeter großen Gewitterwürmchen (Taenothrips ericae), deren Larven im Inneren der Blüten heranwachsen. Als Adulte kommen sie erst für die Paarung und Eiablage heraus.
Für den Pollen als Proviant für den Nestbau interessieren sich drei Wildbienen, die beiden Schmalbienen Lasioglossum calceatum und Lasioglossum prasinum sowie die Mörtelbiene Megachile analis. Honigbienen gehen auf der Suche nach Nektar mit ihren kurzen Zungen an den großen Glöckchen leer aus und behelfen sich bestenfalls mit den Löchern, den Erdhummeln bisweilen hineinbeißen, um an die Beute heranzukommen.
Die Trockenlegung, landwirtschaftliche Nutzung wie auch die Bepflanzung der Moore mit Bäumen und Sträuchern hat die Moor-Glockenheide inzwischen fast an den Rand der Ausrottung gebracht. Man findet die früher recht häufige Pflanze inzwischen häufiger in Gärten als in freier Wildbahn.
Neben der Wildform gibt es im Gartenfachhandel Zuchtsorten mit weißen und hellrosa Blüten.
Im Gegensatz zur unverwüstlichen Besenheide ist die Glockenheide nur bedingt winterhart und überlebt strenge Fröste in den seltensten Fällen. Leichten Frost übersteht sie.
Die Glockenheide blüht von Ende Juni bis September und oft auch bis in den Oktober hinein mit ihren zahlreichen rosafarbenen oder selten weißen Blüten.
Moor-Glockenheide ist in Mitteleuropa heimisch und Nahrungsquelle/Lebensraum für Bienen, Schmetterlinge und Schmetterlingsraupen